

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ
Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно
Скидки до 50 % на комплекты
только до
Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой
Организационный момент
Проверка знаний
Объяснение материала
Закрепление изученного
Итоги урока


Federal President Frank-Walter Steinmeier at the "500 Years of the Twelve Articles" ceremony on March 15, 2025 in Memmingen
Where does our own freedom end when its use becomes a danger to others?
Where does our freedom end when its use destroys the natural foundations of life?
Are we allowed to exercise our freedom at the expense of future generations?
And, last but not least:
How do we protect ourselves and our freedom – from those who threaten it from outside, even without the use of military force, how do we protect it from trolls as well as from the communication power of the tech giants?
History doesn't provide us with ready-made answers to these questions. But it does help us understand that everything we do or don't do here and now has consequences for the lives of people elsewhere and in the future.
It makes us aware:
We all depend on one another,
we bear responsibility for one another, for liberal democracy, and for a future worth living on our planet!
Просмотр содержимого документа
«Federal President Frank-Walter Steinmeier at the "500 Years of the Twelve Articles" ceremony on March 15, 2025 in Memmingen»
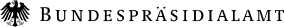
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Festakt „500 Jahre Zwölf Artikel“ am 15. März 2025 in Memmingen
Ich freue mich sehr hier zu sein, an diesem besonderen Ort, in dieser wunderschönen Pfarrkirche St. Martin. Und vor allen Dingen freue ich mich, dabei zu sein, wenn wir heute in Memmingen ein wirklich besonderes Jubiläum feiern – ein Jubiläum, das weit über Ihre Stadt, weit über die Region Oberschwaben hinausstrahlt. Die Zwölf Artikel, die vor 500 Jahren hier entstanden, waren keine Randglosse der deutschen Geschichte, sie waren der Auslöser einer Freiheitsbewegung, die sich im
Frühjahr und Frühsommer 1525 wie ein Lauffeuer über ganz Süd- und Mitteldeutschland verbreitete, vom Bodensee bis in den südlichen Harz.
Memmingen war damals, im Zeitalter der Reformation, der Ausgangspunkt eines Massenaufstands für Freiheit und Recht, wie es ihn dann in West- und Mitteleuropa bis zur Französischen Revolution nicht mehr geben sollte. Dass dieses epochale Ereignis nach seiner blutigen Niederschlagung als „Bauernkrieg“ in die Geschichte eingegangen ist, wird seiner eigentlichen Bedeutung nicht gerecht.
Deshalb ist es gut, dass wir in diesem Jahr an vielen Orten unseres Landes an dieses frühe Kapitel unserer Freiheitsgeschichte erinnern. Und deshalb ist es wichtig, dass wir heute hier in Memmingen deutlich machen: Die Zwölf Artikel sind nicht nur ein herausragendes, sondern vor allen Dingen bleibendes Zeugnis unserer Freiheitsgeschichte, ein Dokument von gesamtdeutscher Bedeutung, das uns bis heute viel zu sagen hat.
Ich bin überzeugt: Die Erinnerung an Orte, Akteure, Ideen und Ereignisse unserer Freiheitsgeschichte ist in dieser unruhigen Zeit wichtiger denn je. Denn wir erleben ja gerade, dass die freiheitliche Demokratie bedroht und angegriffen wird – im Innern wie von außen und mit einer Wucht, die viele von uns doch nicht für möglich gehalten hätten. Und wir erleben zugleich, dass sich ausgerechnet diejenigen auf historische Freiheitsbewegungen berufen, die gegen demokratische
Institutionen hetzen und Freiheit nur für sich selbst und ihresgleichen gelten lassen wollen.
Gerade jetzt brauchen wir deshalb eine historisch aufgeklärte Erinnerung an die vielen mutigen Frauen und Männer, die in der wechselvollen Geschichte unseres Landes immer wieder gegen Unterdrückung, Bevormundung und Privilegien gekämpft haben. An all jene, die unter großen Opfern für das aufgestanden sind, was heute bei uns Wirklichkeit geworden ist: demokratische Selbstbestimmung mit gleicher Freiheit und gleichen Rechten für alle. Die Erinnerung an sie lässt uns klarer erkennen, was unsere freiheitliche Demokratie heute ausmacht, was für einen Wert sie hat.
Und deshalb ist es so wichtig, dass wir heute gemeinsam an das faszinierende „Projekt Freiheit“ erinnern, das vor 500 Jahren in Ihrer Stadt begann. Haben Sie ganz herzlichen Dank für die Einladung!
Hier an diesem Ort, in der Martinskirche von Memmingen, predigte vor 500 Jahren der Prädikant Christoph Schappeler die neue reformatorische Lehre. Nur ein paar Straßen weiter, im Haus der Kramerzunft am Weinmarkt, versammelten sich im März 1525 die Abgeordneten der Bauern vom Bodensee, aus Baltringen und dem Allgäu, schlossen sich zu einer „christlichen Vereinigung“ zusammen und verabschiedeten eine Bundesordnung. Und zur gleichen Zeit arbeitete der Kürschner, Laienprediger und Autor Sebastian Lotzer die Forderungen der Bauern aus den umliegenden Dörfern zu jenen Zwölf Artikeln um, die dann zur wichtigsten Programmschrift der Aufständischen und zur Initialzündung des Bauernkrieges werden sollten.
Salopp gesagt: Im Anfang war das Wort, und das Wort kam aus Memmingen.
Gutenbergs Erfindung machte es möglich, dass im Frühjahr und Frühsommer bis zu 25.000 Exemplare der Zwölf Artikel gedruckt wurden, zuerst in Augsburg, dann in vielen anderen Städten zwischen Straßburg und Breslau. Schnell wie der Wind breitete sich die anonyme Flugschrift über weite Teile des Heiligen Römischen Reiches aus. Sie wurde auf Märkten verkauft, von Reisenden weitergetragen, in Gasthöfen diskutiert, bei Versammlungen unter freiem Himmel vorgelesen.
Die Botschaften aus Memmingen erreichten Bürger und Stadträte, Untertanen und Obrigkeiten, und überall, vom Breisgau bis in den Thüringer Wald, entfachten sie den Protest für mehr Freiheit. Zehntausende Bauern schworen sich auf die Zwölf Artikel ein, machten sie zu ihrem Programm oder passten sie den örtlichen Gegebenheiten an.
Das Geheimnis ihres Erfolges lag sicherlich darin, dass die Flugschrift nicht nur lokalen Bezug hatte und schon im Titel beanspruchte, für „alle Bauernschaft“ zu sprechen. Auf diese Weise schufen die Zwölf Artikel ein Wir, das es zur Zeit ihrer Abfassung noch gar nicht gab. „Wir, die Bauern“ – das hatte große Kraft, vielleicht so wie später das „We, the people“ in der Verfassung der Vereinigten Staaten.
Brisant war auch, dass gleich in der Einleitung behauptet wurde, die erhobenen Forderungen seien durch das Evangelium und das Wort Gottes gerechtfertigt – es sei denn, man weise den Bauern anhand der Bibel nach, dass sie sich in einem bestimmten Punkt geirrt hätten. Wie groß die Sprengkraft war, die in dieser christlichen Aufladung steckte, zeigt sich besonders im berühmten dritten Artikel: Die Forderung nach Abschaffung der Leibeigenschaft wird dort damit begründet, dass Christus die Menschen „mit dem Vergießen all seines kostbaren Bluts erlöst und freigekauft“ habe, „und zwar den Hirten gleichermaßen wie den Höchsten, niemand ausgenommen. Deshalb ergibt sich aus der Schrift, dass wir frei sind und sein wollen.“
Das konnte man schon damals so lesen, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind. Da klingt schon sehr früh die Idee der unveräußerlichen Menschenrechte an, die erst Jahrhunderte später Wirklichkeit geworden sind.
Und noch ein bisschen brisanter: Die Zwölf Artikel werfen auch die grundlegende Frage nach der Legitimität von Herrschaft auf – und beantworten sie anders, als Martin Luther es in seiner Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ getan hatte. Der Reformator aus Wittenberg wollte Freiheit vor allem als „geistliche Freiheit“ verstanden wissen und forderte den unbedingten Gehorsam gegenüber jeder weltlichen Obrigkeit. Die Bauern stellten in den Zwölf Artikeln zwar klar, dass sie keineswegs „ganz und gar frei“, also ohne Obrigkeit sein wollten. Sie fühlten sich aber nicht jeder Obrigkeit zum Gehorsam verpflichtet, sondern nur derjenigen, die ihr Handeln an Gottes Wort ausrichtet, also zum Beispiel „die Rechte der Nächsten“ achtet und
„christlich teilt“.
Auch wenn Schappeler, Lotzer und die Bauern natürlich noch keine
Vorstellung vom modernen Staat oder von moderner Demokratie hatten – hier ist in Ansätzen die Idee einer politischen Ordnung zu erkennen, in der auch die Herrschenden das für alle geltende Recht beachten müssen und an es gebunden sind. In einer monarchisch-feudalen Gesellschaft war das eine wahrhaft revolutionäre Idee.
Die Zwölf Artikel hatten auch darüber hinaus Zukunftsweisendes zu bieten, was uns bis heute berührt, vielleicht sogar prägt Sie enthalten zum Beispiel schon die Idee der gemeindlichen Selbstbestimmung. Sie sprechen sich gegen willkürliche Strafen aus und verlangen schriftlich fixierte Gesetze. Sie wehren sich gegen Ausbeutung und Schinderei und fordern „würdigen“ Lohn. Und sie verlangen, nicht zuletzt, eine gerechte Verteilung von Wäldern, Wiesen und Äckern, von Holz, Fisch und Wild.
Die Zwölf Artikel waren auch deshalb ein so brisantes Dokument, weil sie ganz unterschiedliche Lesarten zuließen. Es ist ein bisschen wie ein Vexierbild, da changiert vieles zwischen Reform und Revolution, zwischen der Rückkehr zu altem Recht und der Vision einer neuen, in „brüderlicher Liebe“ geeinten Welt.
Angesichts der Vielfalt der Akteure dürfen Widersprüche in der Aufstandsbewegung nicht überraschen. Die Aufständischen – Bauern und Tagelöhner, Handwerker und Bürger, niedrige Geistliche und Adlige, fast ausnahmslos Männer – bildeten keine ganz geschlossene Bewegung. Die meisten von ihnen blieben der ständischen Ordnung verhaftet und stellten den Herrschaftsanspruch des Adels nicht in Frage. Manches an ihrem Protest war auch rückwärtsgewandt. Viele Bauernhaufen zelebrierten damals das Männerbündische, und es gab in ihren Reihen auch antiklerikalen und antisemitischen Hass.
Auch in der Frage, ob Gewalt angewendet werden sollte, gab es keine ganz einheitliche Meinung. Sie organisierten und bewaffneten sich – durchaus nicht nur mit Sensen und Dreschflegeln –, zogen trommelnd und pfeifend übers Land, bauten Drohkulissen auf. Sie belagerten, stürmten und plünderten Klöster, gelegentlich auch Adelssitze. Und sie nötigten und zwangen manchen, sich ihnen anzuschließen. Aber die meisten Bauernhaufen waren für Verhandlungen mit den Obrigkeiten und zeigten sich zur Verständigung, zu Kompromissen bereit – auch dafür stehen die Zwölf Artikel und die Memminger Bundesordnung.
Die Gegner der Bauern reagierten trotzdem unerbittlich. Die Zwölf Artikel lösten ein donnerndes publizistisches Echo aus, gerade auch von protestantischen Gelehrten, die ihr Projekt der Reformation gefährdet sahen. Luther, der in seiner „Ermahnung zum Frieden“ Ende April 1525 noch Verständnis für die Forderungen der Bauern erkennen ließ, forderte wenig später in seiner Schrift „Wider die mörderischen und räuberischen Rotten“ die Niederschlagung der Aufstände – und prägte für lange Zeit das öffentliche Bild von den gewalttätigen Bauern.
Dabei war es der Schwäbische Bund, der die militärische
Austragung des Konflikts forcierte. Bei Leipheim richtete das Fürstenheer das erste schreckliche Blutbad an, dem viele weitere folgen sollten: Die Bauern und ihre Verbündeten wurden gnadenlos niedergemetzelt, öffentlich enthauptet, an Bäumen aufgeknüpft. Man brannte ihre Dörfer nieder, tötete auch Frauen und Kinder. Bis zu 100.000 Menschen bezahlten damals ihr Streben nach Freiheit mit dem Leben – eine ungeheuerliche Zahl.
500 Jahre danach ist es höchste Zeit, Sebastian Lotzer, Christoph Schappeler und die Bauern, die hier in Memmingen Freiheitsgeschichte schrieben, auf die Landkarte unserer nationalen Erinnerung zu setzen. 500 Jahre danach ist es höchste Zeit, all jene ins Licht zu rücken, die damals für Freiheit und Gerechtigkeit kämpften! Sie bereiteten den Boden, sie legten die ersten Körner jener Saat, aus der viel später unsere freiheitliche Demokratie wachsen konnte. Wir schulden ihnen Anerkennung und Respekt!
Und wir haben noch so viel mehr zu entdecken und wiederzuentdecken! Hier in Memmingen haben Sie gerade eine Flugschrift aus dem Jahr 1525 erstanden, in der ein unbekannter Stadtbürger in Anknüpfung an die Zwölf Artikel seine Vorstellungen von einer Republik formulierte. Und auch in späteren Jahrhunderten entstand vieles, was wir heute zu Unrecht aus dem Blick verloren haben: die frühen demokratische Manifeste, die deutsche Jakobiner im Zuge der
Französischen Revolution entwickelten; die liberalen
Verfassungsentwürfe aus der Zeit des Vormärz; nicht zuletzt die Forderungen, die vor und während der Revolution von 1848 kursierten.
Ich finde, der Freiheitsbrunnen, den Sie hier in Memmingen auf dem Weinmarkt errichtet haben, der gehört nicht nur in diese Stadt, sondern ich kann mir eigentlich kein stärkeres Symbol vorstellen, denn die frühen Quellen der Freiheit, sie sprudelten überall in unserem Land. Freiheitsideen flossen in vielen Rinnsalen weiter, manche versiegten, andere liefen zu großen Strömen zusammen, die schließlich in Frankfurt am Main, in Weimar, in Herrenchiemsee und Bonn mündeten – in den demokratischen Verfassungen unseres Landes. Und diese Ideen lebten in der DDR wieder auf, als sich die mutigen Frauen und Männer in Plauen, Leipzig, Ost-Berlin und vielen anderen Orten die Freiheit erkämpften – und die freiheitliche Demokratie im geeinten Deutschland möglich machten.
Die Erinnerung an unsere Freiheitsgeschichte macht uns bewusst, was uns als Bürgerinnen und Bürger in diesem Land verbindet und worauf wir wirklich stolz sein können und stolz sein sollten. Auch deshalb ist es wichtig, dass wir heute die gesamtdeutsche Geschichte der Freiheit erzählen. Der Bauernkrieg mit seinen Schauplätzen in Bayern, BadenWürttemberg, Thüringen und Sachsen-Anhalt eignet sich dafür ganz besonders gut.
Der Blick zurück lässt uns auch besser verstehen, was wir heute meinen, wenn wir von Freiheit und Demokratie reden. Deshalb brauchen wir historische Bildung, um denen entgegenzutreten, die sich heute zu Unrecht auf historische Freiheitsbewegungen beziehen, um gegen die Demokratie des Grundgesetzes Front zu machen!
Es bleibt doch richtig: Damals riskierten und verloren mutige Menschen ihr Leben im Kampf um die Freiheit. Heute können wir in unserer freiheitlichen Demokratie Protest äußern und friedlich um den richtigen Weg ringen. Das ist der entscheidende Unterschied!
Und wer heute behauptet, Freiheit bestehe darin, dass man sich nimmt, so viel man kann, auch auf Kosten von Dritten, dem müssen wir sagen: „Ich zuerst“ ohne Rücksicht auf andere – das ist nicht die Freiheit, die unser Grundgesetz meint! In unserer Gesellschaft ist die Freiheit des Einzelnen untrennbar mit der Verantwortung für andere und für das
Gemeinwesen verknüpft. Und in unserer Demokratie ist die Freiheit der
Mehrheit untrennbar mit der Verantwortung verbunden, die Rechte der Minderheit zu achten und zu schützen.
Die Beschäftigung mit den Zwölf Artikeln schärft unseren Blick für Fragen, auf die wir heute Antworten finden müssen. Wo endet die eigene Freiheit, wenn ihr Gebrauch zur Gefahr für andere wird? Wo endet unsere Freiheit, wenn ihr Gebrauch die natürlichen Lebensgrundlagen zerstört? Dürfen wir unsere Freiheit auf Kosten zukünftiger Generationen ausleben? Und, nicht zuletzt: Wie schützen wir uns und unsere Freiheit – vor denen, die sie , auch ohne Einsatz von Militär, von außen bedrohen, wie schützen wir sie vor den Trollen ebenso wie vor der Kommunikationsmacht der Tech-Giganten?
Die Geschichte liefert uns auf diese Fragen keine fertigen Antworten. Aber sie lässt uns begreifen, dass alles, was wir hier und heute tun oder lassen, Folgen für das Leben von Menschen an anderen Orten und in der Zukunft hat. Sie macht uns bewusst: Wir alle sind aufeinander angewiesen, wir tragen Verantwortung füreinander, für die freiheitliche Demokratie und für eine lebenswerte Zukunft auf unserem Planeten!
Wenn wir auf unsere Freiheitsgeschichte zurückschauen, dann stellen wir – vielleicht sogar ein bisschen erstaunt – fest, was mutige Menschen vor langer Zeit erreicht und errungen haben, allen Enttäuschungen und Rückschlägen zum Trotz. Aus der Erinnerung an ihre Kraft und ihre Entschlossenheit sollten wir heute Mut und Zuversicht schöpfen. Stellen wir uns in ihre Tradition, verteidigen wir heute das, wofür sie damals kämpfen mussten!
Mein Dank gilt den vielen Menschen überall in unserem Land, die die Erinnerung lebendig halten und die vor allen Dingen immer wieder gute Ideen haben, um junge Leute für die Freiheitsgeschichte zu begeistern. Ob in Bund, Ländern oder Kommunen, in Stiftungen, Vereinen oder lokalen Initiativen: Sie alle pflegen die Wurzeln unserer Demokratie, und dafür sage ich Ihnen meinen herzlichen Dank!
Ich wünsche den Landesausstellungen zum Bauernkrieg viele Besucherinnen und Besucher – hier in Memmingen ebenso wie in Bad Schussenried, in Mühlhausen und Bad Frankenhausen, in Mansfeld, in Stolberg oder in Allstedt.
Im März 1525 schrieb der Verfasser der Zwölf Artikel hier in Memmingen: Aus der Heiligen Schrift ergibt sich, „dass wir frei sind und sein wollen“. Dass wir es bleiben, frei bleiben, das liegt heute in unser aller Hand! Begegnen wir den Bedrohungen von Freiheit nicht mit Gleichgültigkeit. Die Freiheitsgeschichte, die hier von Memmingen ausging, verpflichtet uns: Das Erbe der Aufständischen von 1525, das
dürfen wir niemals wieder aus der Hand geben!
| Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Festakt „500 Jahre Zwölf Artikel“ am 15. März 2025 in Memmingen
Ich freue mich sehr hier zu sein, an diesem besonderen Ort, in dieser wunderschönen Pfarrkirche St. Martin. Und vor allen Dingen freue ich mich, dabei zu sein, wenn wir heute in Memmingen ein wirklich besonderes Jubiläum feiern – ein Jubiläum, das weit über Ihre Stadt, weit über die Region Oberschwaben hinausstrahlt. Die Zwölf Artikel, die vor 500 Jahren hier entstanden, waren keine Randglosse der deutschen Geschichte, sie waren der Auslöser einer Freiheitsbewegung, die sich im Frühjahr und Frühsommer 1525 wie ein Lauffeuer über ganz Süd- und Mitteldeutschland verbreitete, vom Bodensee bis in den südlichen Harz. Memmingen war damals, im Zeitalter der Reformation, der Ausgangspunkt eines Massenaufstands für Freiheit und Recht, wie es ihn dann in West- und Mitteleuropa bis zur Französischen Revolution nicht mehr geben sollte. Dass dieses epochale Ereignis nach seiner blutigen Niederschlagung als „Bauernkrieg“ in die Geschichte eingegangen ist, wird seiner eigentlichen Bedeutung nicht gerecht. Deshalb ist es gut, dass wir in diesem Jahr an vielen Orten unseres Landes an dieses frühe Kapitel unserer Freiheitsgeschichte erinnern. Und deshalb ist es wichtig, dass wir heute hier in Memmingen deutlich machen: Die Zwölf Artikel sind nicht nur ein herausragendes, sondern vor allen Dingen bleibendes Zeugnis unserer Freiheitsgeschichte, ein Dokument von gesamtdeutscher Bedeutung, das uns bis heute viel zu sagen hat. Ich bin überzeugt: Die Erinnerung an Orte, Akteure, Ideen und Ereignisse unserer Freiheitsgeschichte ist in dieser unruhigen Zeit wichtiger denn je. Denn wir erleben ja gerade, dass die freiheitliche Demokratie bedroht und angegriffen wird – im Innern wie von außen und mit einer Wucht, die viele von uns doch nicht für möglich gehalten hätten. Und wir erleben zugleich, dass sich ausgerechnet diejenigen auf historische Freiheitsbewegungen berufen, die gegen demokratische Institutionen hetzen und Freiheit nur für sich selbst und ihresgleichen gelten lassen wollen. Gerade jetzt brauchen wir deshalb eine historisch aufgeklärte Erinnerung an die vielen mutigen Frauen und Männer, die in der wechselvollen Geschichte unseres Landes immer wieder gegen Unterdrückung, Bevormundung und Privilegien gekämpft haben. An all jene, die unter großen Opfern für das aufgestanden sind, was heute bei uns Wirklichkeit geworden ist: demokratische Selbstbestimmung mit gleicher Freiheit und gleichen Rechten für alle. Die Erinnerung an sie lässt uns klarer erkennen, was unsere freiheitliche Demokratie heute ausmacht, was für einen Wert sie hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir heute gemeinsam an das faszinierende „Projekt Freiheit“ erinnern, das vor 500 Jahren in Ihrer Stadt begann. Haben Sie ganz herzlichen Dank für die Einladung! Hier an diesem Ort, in der Martinskirche von Memmingen, predigte vor 500 Jahren der Prädikant Christoph Schappeler die neue reformatorische Lehre. Nur ein Paar Straßen weiter, im Haus der Kramerzunft am Weinmarkt, versammelten sich im März 1525 die Abgeordneten der Bauern vom Bodensee, aus Baltringen und dem Allgäu, schlossen sich zu einer „christlichen Vereinigung“ zusammen und verabschiedeten eine Bundesordnung. Und zur gleichen Zeit arbeitete der Kürschner, Laienprediger und Autor Sebastian Lotzer die Forderungen der Bauern aus den umliegenden Dörfern zu jenen Zwölf Artikeln um, die dann zur wichtigsten Programmschrift der Aufständischen und zur Initialzündung des Bauernkrieges Warden sollten. Salopp gesagt: Im Anfang war das Wort, und das Wort kam aus Memmingen. Gutenbergs Erfindung machte es möglich, dass im Frühjahr und Frühsommer bis zu 25.000 Exemplare der Zwölf Artikel gedruckt wurden, zuerst in Augsburg, dann in vielen anderen Städten zwischen Straßburg und Breslau. Schnell wie der Wind breitete sich die anonyme Flugschrift über weite Teile des Heiligen Römischen Reiches aus. Sie wurde auf Märkten verkauft, von Reisenden weitergetragen, in Gasthöfen diskutiert, bei Versammlungen unter freiem Himmel vorgelesen. Die Botschaften aus Memmingen erreichten Bürger und Stadträte, Untertanen und Obrigkeiten, und überall, vom Breisgau bis in den Thüringer Wald, entfachten sie den Protest für mehr Freiheit. Zehntausende Bauern schworen sich auf die Zwölf Artikel ein, machten sie zu ihrem Programm oder passten sie den örtlichen Gegebenheiten an. Das Geheimnis ihres Erfolges lag sicherlich darin, dass die Flugschrift nicht nur lokalen Bezug hatte und schon im Titel beanspruchte, für „alle Bauernschaft“ zu sprechen. Auf diese Weise schufen die Zwölf Artikel ein Wir, das es zur Zeit ihrer Abfassung noch gar nicht gab. „Wir, die Bauern“ – das hatte große Kraft, vielleicht so wie später das „We, the people“ in der Verfassung der Vereinigten Staaten. Brisant war auch, dass gleich in der Einleitung behauptet wurde, die erhobenen Forderungen seien durch das Evangelium und das Wort Gottes gerechtfertigt – es sei denn, man weise den Bauern anhand der Bibel nach, dass sie sich in einem bestimmten Punkt geirrt hätten. Wie groß die Sprengkraft war, die in dieser christlichen Aufladung steckte, zeigt sich besonders im berühmten Dritten Artikel: Die Forderung nach Abschaffung der Leibeigenschaft wird dort damit begründet, dass Christus die Menschen „mit dem Vergießen all seines kostbaren Bluts erlöst und freigekauft“ habe, „und zwar den Hirten gleichermaßen wie den Höchsten, niemand ausgenommen. Deshalb ergibt sich aus der Schrift, dass wir frei sind und sein wollen.“ Das konnte man schon damals so lesen, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind. Da klingt schon sehr früh die Idee der unveräußerlichen Menschenrechte an, die erst Jahrhunderte später Wirklichkeit geworden sind. Und noch ein bisschen brisanter: Die Zwölf Artikel werfen auch die grundlegende Frage nach der Legitimität von Herrschaft auf – und beantworten sie anders, als Martin Luther es in seiner Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ getan hatte. Der Reformator aus Wittenberg wollte Freiheit vor allem als „geistliche Freiheit“ verstanden wissen und forderte den unbedingten Gehorsam gegenüber jeder weltlichen Obrigkeit. Die Bauern stellten in den Zwölf Artikeln zwar klar, dass sie keineswegs „ganz und gar frei“, also ohne Obrigkeit sein wollten. Sie fühlten sich aber nicht jeder Obrigkeit zum Gehorsam verpflichtet, sondern nur derjenigen, die ihr Handeln an Gottes Wort ausrichtet, also zum Beispiel „die Rechte der Nächsten“ achtet und „christlich teilt“. Auch wenn Schappeler, Lotzer und die Bauern natürlich noch keine Vorstellung vom modernen Staat oder von moderner Demokratie hatten – hier ist in Ansätzen die Idee einer politischen Ordnung zu erkennen, in der auch die Herrschenden das für alle geltende Recht beachten müssen und an es gebunden sind. In einer monarchisch-feudalen Gesellschaft war das eine wahrhaft revolutionäre Idee. Die Zwölf Artikel hatten auch darüber hinaus Zukunftsweisendes zu bieten, was uns bis heute berührt, vielleicht sogar prägt Sie enthalten zum Beispiel schon die Idee der gemeindlichen Selbstbestimmung. Sie sprechen sich gegen willkürliche Strafen aus und verlangen schriftlich fixierte Gesetze. Sie wehren sich gegen Ausbeutung und Schinderei und fordern „würdigen“ Lohn. Und sie verlangen, nicht zuletzt, eine gerechte Verteilung von Wäldern, Wiesen und Äckern, von Holz, Fisch und Wild. Die Zwölf Artikel waren auch deshalb ein so brisantes Dokument, weil sie ganz unterschiedliche Lesarten zuließen. Es ist ein bisschen wie ein Vexierbild, da changiert vieles zwischen Reform und Revolution, zwischen der Rückkehr zu altem Recht und der Vision einer neuen, in „brüderlicher Liebe“ geeinten Welt. Angesichts der Vielfalt der Akteure dürfen Widersprüche in der Aufstandsbewegung nicht überraschen. Die Aufständischen – Bauern und Tagelöhner, Handwerker und Bürger, niedrige Geistliche und Adlige, fast ausnahmslos Männer – bildeten keine ganz geschlossene Bewegung. Die meisten von ihnen blieben der ständischen Ordnung verhaftet und stellten den Herrschaftsanspruch des Adels nicht in Frage. Manches an ihrem Protest war auch rückwärtsgewandt. Viele Bauernhaufen zelebrierten damals das Männerbündische, und es gab in ihren Reihen auch antiklerikalen und antisemitischen Hass. Auch in der Frage, ob Gewalt angewendet werden sollte, gab es keine ganz einheitliche Meinung. Sie organisierten und bewaffneten sich – durchaus nicht nur mit Sensen und Dreschflegeln –, zogen trommelnd und pfeifend übers Land, bauten Drohkulissen auf. Sie belagerten, stürmten und plünderten Klöster, gelegentlich auch Adelssitze. Und sie nötigten und zwangen manchen, sich ihnen anzuschließen. Aber die meisten Bauernhaufen waren für Verhandlungen mit den Obrigkeiten und zeigten sich zur Verständigung, zu Kompromissen bereit – auch dafür stehen die Zwölf Artikel und die Memminger Bundesordnung. Die Gegner der Bauern reagierten trotzdem unerbittlich. Die Zwölf Artikel lösten ein donnerndes publizistisches Echo aus, gerade auch von protestantischen Gelehrten, die ihr Projekt der Reformation gefährdet sahen. Luther, der in seiner „Ermahnung zum Frieden“ Ende April 1525 noch Verständnis für die Forderungen der Bauern erkennen ließ, forderte wenig später in seiner Schrift „Wider die mörderischen und räuberischen Rotten“ die Niederschlagung der Aufstände – und prägte für lange Zeit das öffentliche Bild von den gewalttätigen Bauern. Dabei war es der Schwäbische Bund, der die militärische Austragung des Konflikts forcierte. Bei Leipheim richtete das Fürstenheer das erste schreckliche Blutbad an, dem viele weitere folgen sollten: Die Bauern und ihre Verbündeten wurden gnadenlos niedergemetzelt, öffentlich enthauptet, an Bäumen aufgeknüpft. Man brannte ihre Dörfer nieder, tötete auch Frauen und Kinder. Bis zu 100.000 Menschen bezahlten damals ihr Streben nach Freiheit mit dem Leben – eine ungeheuerliche Zahl. 500 Jahre danach ist es höchste Zeit, Sebastian Lotzer, Christoph Schappeler und die Bauern, die hier in Memmingen Freiheitsgeschichte schrieben, auf die Landkarte unserer nationalen Erinnerung zu setzen. 500 Jahre danach ist es höchste Zeit, all jene ins Licht zu rücken, die damals für Freiheit und Gerechtigkeit kämpften! Sie bereiteten den Boden, sie legten die ersten Körner jener Saat, aus der viel später unsere freiheitliche Demokratie wachsen konnte. Wir schulden ihnen Anerkennung und Respekt! Und wir haben noch so viel mehr zu entdecken und wiederzuentdecken! Hier in Memmingen haben Sie gerade eine Flugschrift aus dem Jahr 1525 erstanden, in der ein unbekannter Stadtbürger in Anknüpfung an die Zwölf Artikel seine Vorstellungen von einer Republik formulierte. Und auch in späteren Jahrhunderten entstand vieles, was wir heute zu Unrecht aus dem Blick verloren haben: die frühen demokratische Manifeste, die deutsche Jakobiner im Zuge der Französischen Revolution entwickelten; die liberalen Verfassungsentwürfe aus der Zeit des Vormärz; nicht zuletzt die Forderungen, die vor und während der Revolution von 1848 kursierten. Ich finde, der Freiheitsbrunnen, den Sie hier in Memmingen auf dem Weinmarkt errichtet haben, der gehört nicht nur in diese Stadt, sondern ich kann mir eigentlich kein stärkeres Symbol vorstellen, denn die frühen Quellen der Freiheit, sie sprudelten überall in unserem Land. Freiheitsideen flossen in vielen Rinnsalen weiter, manche versiegten, andere liefen zu großen Strömen zusammen, die schließlich in Frankfurt am Main, in Weimar, in Herrenchiemsee und Bonn mündeten – in den demokratischen Verfassungen unseres Landes. Und diese Ideen lebten in der DDR wieder auf, als sich die mutigen Frauen und Männer in Plauen, Leipzig, Ost-Berlin und vielen anderen Orten die Freiheit erkämpften – und die freiheitliche Demokratie im geeinten Deutschland möglich machten. Die Erinnerung an unsere Freiheitsgeschichte macht uns bewusst, was uns als Bürgerinnen und Bürger in diesem Land verbindet und worauf wir wirklich stolz sein können und stolz sein sollten. Auch deshalb ist es wichtig, dass wir heute die gesamtdeutsche Geschichte der Freiheit erzählen. Der Bauernkrieg mit seinen Schauplätzen in Bayern, BadenWürttemberg, Thüringen und Sachsen-Anhalt eignet sich dafür ganz besonders gut. Der Blick zurück lässt uns auch besser verstehen, was wir heute meinen, wenn wir von Freiheit und Demokratie reden. Deshalb brauchen wir historische Bildung, um denen entgegenzutreten, die sich heute zu Unrecht auf historische Freiheitsbewegungen beziehen, um gegen die Demokratie des Grundgesetzes Front zu machen! Es bleibt doch richtig: Damals riskierten und verloren mutige Menschen ihr Leben im Kampf um die Freiheit. Heute Können wir in unserer freiheitlichen Demokratie Protest äußern und friedlich um den richtigen Weg ringen. Das ist der entscheidende Unterschied! Und wer heute behauptet, Freiheit bestehe darin, dass man sich nimmt, so viel man kann, auch auf Kosten von Dritten, dem müssen wir sagen: „Ich zuerst“ ohne Rücksicht auf andere – das ist nicht die Freiheit, die unser Grundgesetz meint! In unserer Gesellschaft ist die Freiheit des Einzelnen untrennbar mit der Verantwortung für andere und für das Gemeinwesen verknüpft. Und in unserer Demokratie ist die Freiheit der Mehrheit untrennbar mit der Verantwortung verbunden, die Rechte der Minderheit zu achten und zu schützen. Die Beschäftigung mit den Zwölf Artikeln schärft unseren Blick für Fragen, auf die wir heute Antworten finden müssen. Wo endet die eigene Freiheit, wenn ihr Gebrauch zur Gefahr für andere wird? Wo endet unsere Freiheit, wenn ihr Gebrauch die natürlichen Lebensgrundlagen zerstört? Dürfen wir unsere Freiheit auf Kosten zukünftiger Generationen ausleben? Und, nicht zuletzt: Wie schützen wir uns und unsere Freiheit – vor denen, die sie , auch ohne Einsatz von Militär, von außen bedrohen, wie schützen wir sie vor den Trollen ebenso wie vor der Kommunikationsmacht der Tech-Giganten? Die Geschichte liefert uns auf diese Fragen keine fertigen Antworten. Aber sie lässt uns begreifen, dass alles, was wir hier und heute tun oder lassen, Folgen für das Leben von Menschen an anderen Orten und in der Zukunft hat. Sie macht uns bewusst: Wir alle sind aufeinander angewiesen, wir tragen Verantwortung füreinander, für die freiheitliche Demokratie und für eine lebenswerte Zukunft auf unserem Planeten! Wenn wir auf unsere Freiheitsgeschichte zurückschauen, dann stellen wir – vielleicht sogar ein bisschen erstaunt – fest, was mutige Menschen vor langer Zeit erreicht und errungen haben, allen Enttäuschungen und Rückschlägen zum Trotz. Aus der Erinnerung an ihre Kraft und ihre Entschlossenheit sollten wir heute Mut und Zuversicht schöpfen. Stellen wir uns in ihre Tradition, verteidigen wir heute das, wofür sie damals kämpfen mussten! Mein Dank gilt den vielen Menschen überall in unserem Land, die die Erinnerung lebendig halten und die vor allen Dingen immer wieder gute Ideen haben, um junge Leute für die Freiheitsgeschichte zu begeistern. Ob in Bund, Ländern oder Kommunen, in Stiftungen, Vereinen oder lokalen Initiativen: Sie alle pflegen die Wurzeln unserer Demokratie, und dafür sage ich Ihnen meinen herzlichen Dank! Ich wünsche den Landesausstellungen zum Bauernkrieg viele Besucherinnen und Besucher – hier in Memmingen ebenso wie in Bad Schussenried, in Mühlhausen und Bad Frankenhausen, in Mansfeld, in Stolberg oder in Allstedt. Im März 1525 schrieb der Verfasser der Zwölf Artikel hier in Memmingen: Aus der Heiligen Schrift ergibt sich, „dass wir frei sind und sein wollen“. Dass wir es bleiben, frei bleiben, das liegt heute in unser aller Hand! Begegnen wir den Bedrohungen von Freiheit nicht mit Gleichgültigkeit. Die Freiheitsgeschichte, die hier von Memmingen ausging, verpflichtet uns: Das Erbe der Aufständischen von 1525, das dürfen wir niemals wieder aus der Hand geben! | Federal President Frank-Walter Steinmeier at the "500 Years of the Twelve Articles" ceremony on March 15, 2025 in Memmingen I am very pleased to be here, at this special place, in this beautiful parish church of St. Martin. And above all, I am delighted to be here as we celebrate a truly special anniversary today in Memmingen – an anniversary that resonates far beyond your city, far beyond the Upper Swabia region. The Twelve Articles, which originated here 500 years ago, were not a marginal note in German history; they were the trigger for a freedom movement that spread like wildfire across southern and central Germany in the spring and early summer of 1525, from Lake Constance to the southern Harz Mountains. Back then, in the age of the Reformation, Memmingen was the starting point of a mass uprising for freedom and justice, the likes of which would not be seen again in Western and Central Europe until the French Revolution. The fact that this epochal event went down in history as the "Peasants' War" after its Bloody suppression does not do justice to its true significance. That is why it is good that this year, in many places throughout our country, we are remembering this early chapter in our history of freedom. And that is why it is important that we make it clear here in Memmingen today: The Twelve Articles are not only an outstanding, but above all a lasting testimony to our history of freedom, a document of pan-German importance, that still has much to say to us today. I am convinced: Remembering the places, actors, ideas, and events of our history of freedom is more important than ever in these turbulent times. Because we are currently experiencing that liberal democracy is being threatened and attacked – both internally and externally, and with a force that many of us would never have thought possible. And at the same time, we are experiencing that those who are inciting hatred against democratic institutions and want freedom to apply only to themselves and their peers are the very ones who are invoking historical freedom movements. Right now, therefore, we need a historically enlightened remembrance of the many courageous women and men who, in the eventful history of our country, have repeatedly fought against oppression, paternalism, and privilege. To all those who, at great sacrifice, stood up for what has become reality for us today: democratic self-determination with equal freedom and equal rights for all. Remembering them allows us to see more clearly what our liberal democracy is all about today, what value it has. And that's why it's so important that we remember together today the fascinating "Project Freedom" that began 500 years ago in your city. Thank you very much for the invitation! Here at this very place, in St. Martin's Church in Memmingen, 500 years ago, the preacher Christoph Schappeler preached the new Reformation doctrine. Just A few streets further, in the Kramerzunft building on Weinmarkt, the representatives of the peasants from Lake Constance, Baltringen, and the Allgäu gathered in March 1525, joined together to form a "Christian Association," and adopted a federal constitution. And at the same time, the furrier, lay preacher, and author Sebastian Lotzer reworked the demands of the peasants from the surrounding villages into the Twelve Articles, which later became the most important manifesto of the insurgents and the initial spark of the Peasants' War. To put it bluntly: In the beginning was the Word, and the Word came from Memmingen. Gutenberg's invention made it possible for up to 25,000 copies of the Twelve Articles to be printed in the spring and early summer, first in Augsburg, then in many other cities between Strasbourg and Breslau. Fast as the wind, the anonymous pamphlet spread across large parts of the Holy Roman Empire. It was sold at markets, carried by travelers, discussed in inns, and read aloud at open-air gatherings. The messages from Memmingen reached citizens and city councils, subjects and authorities, and everywhere, from Breisgau to the Thuringian Forest, they sparked protests for more freedom. Tens of thousands of peasants swore themselves to the Twelve Articles, made them their platform, or adapted them to local conditions. The secret of its success certainly lay in the fact that the pamphlet not only had a local appeal and claimed, even in its title, to speak for "all peasants." In this way, the Twelve Articles created a "we" that didn't even exist at the time they were written. "We, the peasants" – that had great power, perhaps like the later "We, the people" in the United States Constitution. What was also explosive was that the very introduction claimed that the demands raised were justified by the Gospel and the Word of God – unless the peasants were shown, using the Bible, that they were wrong on a certain point. The explosive power of this Christian charge is particularly evident in the famous Third Article: The demand for the abolition of serfdom is justified there by the fact that Christ "redeemed and ransomed humanity by shedding all his precious blood," "both the shepherds and the Most High, excluding no one." Therefore, it follows from Scripture that we are and desire to be free." Even back then, this could be interpreted as meaning that all people are born free and equal in dignity and rights. The idea of inalienable human rights, which only became reality centuries later, is already present here very early on. And a bit more explosive: The Twelve Articles also raise the fundamental question of the legitimacy of rule – and answer it differently than Martin Luther did in his work "On the Freedom of a Christian." The reformer from Wittenberg wanted freedom to be understood primarily as "spiritual freedom" and demanded unconditional obedience to all secular authorities. In the Twelve Articles, the peasants made it clear that they did not want to be "completely free," i.e., without authority. However, they did not feel obligated to obey every authority, but only those who align their actions with God's Word, for example, respecting "the rights of their neighbors" and "sharing in a Christian manner." Even though Schappeler, Lotzer, and the farmers naturally had no concept of a modern state or modern democracy, here we can see the beginnings of the idea of a political order in which even those in power must observe the law that applies to all and are bound by it. In a monarchical-feudal society, this was a truly revolutionary idea. The Twelve Articles also offered forward-looking ideas that still touch us today, perhaps Even shape us. For example, they contain the idea of communal self-determination. They speak out against arbitrary punishments and demand written laws. They oppose exploitation and drudgery and demand "decent" wages. And, last but not least, they demand a fair distribution of forests, meadows, and fields, of wood, fish, and wild meat. The Twelve Articles were such a controversial document because they allowed for very different interpretations. It's a bit like a puzzle, with much oscillating between reform and revolution, between a return to the old law and the vision of a new world united in "brotherly love." Given the diversity of the actors, contradictions in the uprising should not be surprising. The insurgents – peasants and day laborers, artisans and burghers, lower clergy and nobles, almost exclusively men – did not form a completely cohesive movement. Most of them remained committed to the estate system and did not question the nobility's claim to power. Some aspects of their protest were also backward-looking. Many peasant groups at the time celebrated the male bond, and there was also anti-clerical and anti-Semitic hatred within their ranks. There was also no unanimous opinion on the question of whether violence should be used. They organized and armed themselves – and not only with scythes and flails – marched across the countryside, drumming and whistling, and created threatening scenarios. They besieged, stormed, and plundered monasteries, and occasionally noble estates. And they coerced and forced some to join them. But most peasant groups were in favor of negotiations with the authorities and showed themselves willing to reach an understanding and compromise – this is also reflected in the Twelve Articles and the Memmingen Federal Order. The peasants' opponents nevertheless reacted relentlessly. The Twelve Articles triggered a thunderous response in the press, especially among Protestant scholars who saw their Reformation project threatened. Luther, who in his "Exhortation to Peace" at the end of April 1525 still expressed understanding for the peasants' demands, demanded the suppression of the uprisings a short time later in his treatise "Against the Murderous and Robberous Hordes" – and shaped the public image of the violent peasants for a long time. It was the Swabian League that pushed for a military settlement of the conflict. At Leipheim, the princely army carried out the first terrible massacre, which was to be followed by many more: The peasants and their allies were mercilessly massacred, publicly beheaded, and hanged from trees. Their villages were burned down, and women and children were also killed. Up to 100,000 people paid with their lives for their quest for freedom back then – an incredible number. 500 years later, it is high time to place Sebastian Lotzer, Christoph Schappeler, and the farmers who wrote freedom history here in Memmingen on the map of our national memory. 500 years later, it is high time to shine a light on all those who fought for freedom and justice back then! They prepared the ground, they planted the first seeds of the seeds from which our liberal democracy could grow much later. We owe them recognition and respect! And we still have so much more to discover and rediscover! Here in Memmingen, you have just purchased a pamphlet from 1525 in which an unknown citizen formulated his ideas for a republic based on the Twelve Articles. And even in later centuries, much emerged that we have unjustly lost sight of today: the early democratic manifestos developed by German Jacobins during the French Revolution; the liberal constitutional drafts from the Vormärz period; not least, the demands that circulated before and during the 1848 Revolution. I believe that the Fountain of Freedom, which you erected here in Memmingen on the Weinmarkt, not only belongs to this city, but I can't really imagine a more powerful symbol, for the early sources of freedom bubbled up everywhere in our country. Ideas of freedom continued to flow in many rivulets, some dried up, others converged into great streams that ultimately flowed in Frankfurt am Main, in Weimar, in Herrenchiemsee, and Bonn – in the democratic constitutions of our country. And these ideas were revived in the GDR, when the courageous women and men in Plauen, Leipzig, East Berlin and many other places fought for freedom – and made liberal democracy possible in a united Germany. Remembering our history of freedom makes us aware of what unites us as citizens in this country and what we can and should be truly proud of. This is another reason why it is important that we tell the all-German history of freedom today. The Peasants' War, with its scenes in Bavaria, Baden-Württemberg, Thuringia, and Saxony-Anhalt, is particularly well-suited for this. Looking back also helps us better understand what we mean today when we talk about freedom and democracy. That is why we need historical education to counter those who today wrongfully refer to historical freedom movements to take a stand against the democracy of the Basic Law! It remains true: Back then, courageous people risked and lost their lives in the fight for freedom. Today in our free democracy we can express protest and peacefully struggle for the right path. That is the crucial difference! And to those who claim today that freedom consists in taking as much as one can, even at the expense of others, we must say: "Me first" without consideration for others – that is not the freedom our Basic Law means! In our society, the freedom of the individual is inextricably linked to responsibility for others and for the community. And in our democracy, the freedom of the majority is inextricably linked to the responsibility to respect and protect the rights of the minority. Studying the Twelve Articles sharpens our awareness of questions to which we must find answers today. Where does our own freedom end when its use becomes a danger to others? Where does our freedom end when its use destroys the natural foundations of life? Are we allowed to exercise our freedom at the expense of future generations? And, last but not least: How do we protect ourselves and our freedom – from those who threaten it from outside, even without the use of military force, how do we protect it from trolls as well as from the communication power of the tech giants? History doesn't provide us with ready-made answers to these questions. But it does help us understand that everything we do or don't do here and now has consequences for the lives of people elsewhere and in the future. It makes us aware: We all depend on one another, we bear responsibility for one another, for liberal democracy, and for a future worth living on our planet! When we look back on our history of freedom, we realize – perhaps even with a little astonishment – what courageous people achieved and conquered long ago, despite all the disappointments and setbacks. We should draw courage and confidence today from the memory of their strength and determination. Let us stand in their tradition, let us defend today what they had to fight for back then! My thanks go to the many people throughout our country who keep the memory alive and, above all, who always have good ideas to inspire young people about the history of freedom. Whether at federal, state, or municipal levels, in foundations, associations, or local initiatives: You all nurture the roots of our democracy, and for that, I extend my heartfelt thanks! I wish many visitors to the state exhibitions on the Peasants' War – here in Memmingen as well as in Bad Schussenried, in Mühlhausen and Bad Frankenhausen, in Mansfeld, in Stolberg, and in Allstedt. In March 1525, the author of the Twelve Articles wrote here in Memmingen: From the Holy Scriptures it follows "that we are free and want to be." That we remain so, that we remain free, is in all of our hands today! Let us not meet the threats to freedom with indifference. The history of freedom that began here in Memmingen obligates us: We must never again relinquish the legacy of the rebels of 1525! |
| Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Festakt „500 Jahre Zwölf Artikel“ am 15. März 2025 in Memmingen
Ich freue mich sehr hier zu sein, an diesem besonderen Ort, in dieser wunderschönen Pfarrkirche St. Martin. Und vor allen Dingen freue ich mich, dabei zu sein, wenn wir heute in Memmingen ein wirklich besonderes Jubiläum feiern – ein Jubiläum, das weit über Ihre Stadt, weit über die Region Oberschwaben hinausstrahlt. Die Zwölf Artikel, die vor 500 Jahren hier entstanden, waren keine Randglosse der deutschen Geschichte, sie waren der Auslöser einer Freiheitsbewegung, die sich im Frühjahr und Frühsommer 1525 wie ein Lauffeuer über ganz Süd- und Mitteldeutschland verbreitete, vom Bodensee bis in den südlichen Harz. Memmingen war damals, im Zeitalter der Reformation, der Ausgangspunkt eines Massenaufstands für Freiheit und Recht, wie es ihn dann in West- und Mitteleuropa bis zur Französischen Revolution nicht mehr geben sollte. Dass dieses epochale Ereignis nach seiner blutigen Niederschlagung als „Bauernkrieg“ in die Geschichte eingegangen ist, wird seiner eigentlichen Bedeutung nicht gerecht. Deshalb ist es gut, dass wir in diesem Jahr an vielen Orten unseres Landes an dieses frühe Kapitel unserer Freiheitsgeschichte erinnern. Und deshalb ist es wichtig, dass wir heute hier in Memmingen deutlich machen: Die Zwölf Artikel sind nicht nur ein herausragendes, sondern vor allen Dingen bleibendes Zeugnis unserer Freiheitsgeschichte, ein Dokument von gesamtdeutscher Bedeutung, das uns bis heute viel zu sagen hat. Ich bin überzeugt: Die Erinnerung an Orte, Akteure, Ideen und Ereignisse unserer Freiheitsgeschichte ist in dieser unruhigen Zeit wichtiger denn je. Denn wir erleben ja gerade, dass die freiheitliche Demokratie bedroht und angegriffen wird – im Innern wie von außen und mit einer Wucht, die viele von uns doch nicht für möglich gehalten hätten. Und wir erleben zugleich, dass sich ausgerechnet diejenigen auf historische Freiheitsbewegungen berufen, die gegen demokratische Institutionen hetzen und Freiheit nur für sich selbst und ihresgleichen gelten lassen wollen. Gerade jetzt brauchen wir deshalb eine historisch aufgeklärte Erinnerung an die vielen mutigen Frauen und Männer, die in der wechselvollen Geschichte unseres Landes immer wieder gegen Unterdrückung, Bevormundung und Privilegien gekämpft haben. An all jene, die unter großen Opfern für das aufgestanden sind, was heute bei uns Wirklichkeit geworden ist: demokratische Selbstbestimmung mit gleicher Freiheit und gleichen Rechten für alle. Die Erinnerung an sie lässt uns klarer erkennen, was unsere freiheitliche Demokratie heute ausmacht, was für einen Wert sie hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir heute gemeinsam an das faszinierende „Projekt Freiheit“ erinnern, das vor 500 Jahren in Ihrer Stadt begann. Haben Sie ganz herzlichen Dank für die Einladung! Hier an diesem Ort, in der Martinskirche von Memmingen, predigte vor 500 Jahren der Prädikant Christoph Schappeler die neue reformatorische Lehre. Nur ein Paar Straßen weiter, im Haus der Kramerzunft am Weinmarkt, versammelten sich im März 1525 die Abgeordneten der Bauern vom Bodensee, aus Baltringen und dem Allgäu, schlossen sich zu einer „christlichen Vereinigung“ zusammen und verabschiedeten eine Bundesordnung. Und zur gleichen Zeit arbeitete der Kürschner, Laienprediger und Autor Sebastian Lotzer die Forderungen der Bauern aus den umliegenden Dörfern zu jenen Zwölf Artikeln um, die dann zur wichtigsten Programmschrift der Aufständischen und zur Initialzündung des Bauernkrieges Warden sollten. Salopp gesagt: Im Anfang war das Wort, und das Wort kam aus Memmingen. Gutenbergs Erfindung machte es möglich, dass im Frühjahr und Frühsommer bis zu 25.000 Exemplare der Zwölf Artikel gedruckt wurden, zuerst in Augsburg, dann in vielen anderen Städten zwischen Straßburg und Breslau. Schnell wie der Wind breitete sich die anonyme Flugschrift über weite Teile des Heiligen Römischen Reiches aus. Sie wurde auf Märkten verkauft, von Reisenden weitergetragen, in Gasthöfen diskutiert, bei Versammlungen unter freiem Himmel vorgelesen. Die Botschaften aus Memmingen erreichten Bürger und Stadträte, Untertanen und Obrigkeiten, und überall, vom Breisgau bis in den Thüringer Wald, entfachten sie den Protest für mehr Freiheit. Zehntausende Bauern schworen sich auf die Zwölf Artikel ein, machten sie zu ihrem Programm oder passten sie den örtlichen Gegebenheiten an. Das Geheimnis ihres Erfolges lag sicherlich darin, dass die Flugschrift nicht nur lokalen Bezug hatte und schon im Titel beanspruchte, für „alle Bauernschaft“ zu sprechen. Auf diese Weise schufen die Zwölf Artikel ein Wir, das es zur Zeit ihrer Abfassung noch gar nicht gab. „Wir, die Bauern“ – das hatte große Kraft, vielleicht so wie später das „We, the people“ in der Verfassung der Vereinigten Staaten. Brisant war auch, dass gleich in der Einleitung behauptet wurde, die erhobenen Forderungen seien durch das Evangelium und das Wort Gottes gerechtfertigt – es sei denn, man weise den Bauern anhand der Bibel nach, dass sie sich in einem bestimmten Punkt geirrt hätten. Wie groß die Sprengkraft war, die in dieser christlichen Aufladung steckte, zeigt sich besonders im berühmten Dritten Artikel: Die Forderung nach Abschaffung der Leibeigenschaft wird dort damit begründet, dass Christus die Menschen „mit dem Vergießen all seines kostbaren Bluts erlöst und freigekauft“ habe, „und zwar den Hirten gleichermaßen wie den Höchsten, niemand ausgenommen. Deshalb ergibt sich aus der Schrift, dass wir frei sind und sein wollen.“ Das konnte man schon damals so lesen, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind. Da klingt schon sehr früh die Idee der unveräußerlichen Menschenrechte an, die erst Jahrhunderte später Wirklichkeit geworden sind. Und noch ein bisschen brisanter: Die Zwölf Artikel werfen auch die grundlegende Frage nach der Legitimität von Herrschaft auf – und beantworten sie anders, als Martin Luther es in seiner Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ getan hatte. Der Reformator aus Wittenberg wollte Freiheit vor allem als „geistliche Freiheit“ verstanden wissen und forderte den unbedingten Gehorsam gegenüber jeder weltlichen Obrigkeit. Die Bauern stellten in den Zwölf Artikeln zwar klar, dass sie keineswegs „ganz und gar frei“, also ohne Obrigkeit sein wollten. Sie fühlten sich aber nicht jeder Obrigkeit zum Gehorsam verpflichtet, sondern nur derjenigen, die ihr Handeln an Gottes Wort ausrichtet, also zum Beispiel „die Rechte der Nächsten“ achtet und „christlich teilt“. Auch wenn Schappeler, Lotzer und die Bauern natürlich noch keine Vorstellung vom modernen Staat oder von moderner Demokratie hatten – hier ist in Ansätzen die Idee einer politischen Ordnung zu erkennen, in der auch die Herrschenden das für alle geltende Recht beachten müssen und an es gebunden sind. In einer monarchisch-feudalen Gesellschaft war das eine wahrhaft revolutionäre Idee. Die Zwölf Artikel hatten auch darüber hinaus Zukunftsweisendes zu bieten, was uns bis heute berührt, vielleicht sogar prägt Sie enthalten zum Beispiel schon die Idee der gemeindlichen Selbstbestimmung. Sie sprechen sich gegen willkürliche Strafen aus und verlangen schriftlich fixierte Gesetze. Sie wehren sich gegen Ausbeutung und Schinderei und fordern „würdigen“ Lohn. Und sie verlangen, nicht zuletzt, eine gerechte Verteilung von Wäldern, Wiesen und Äckern, von Holz, Fisch und Wild. Die Zwölf Artikel waren auch deshalb ein so brisantes Dokument, weil sie ganz unterschiedliche Lesarten zuließen. Es ist ein bisschen wie ein Vexierbild, da changiert vieles zwischen Reform und Revolution, zwischen der Rückkehr zu altem Recht und der Vision einer neuen, in „brüderlicher Liebe“ geeinten Welt. Angesichts der Vielfalt der Akteure dürfen Widersprüche in der Aufstandsbewegung nicht überraschen. Die Aufständischen – Bauern und Tagelöhner, Handwerker und Bürger, niedrige Geistliche und Adlige, fast ausnahmslos Männer – bildeten keine ganz geschlossene Bewegung. Die meisten von ihnen blieben der ständischen Ordnung verhaftet und stellten den Herrschaftsanspruch des Adels nicht in Frage. Manches an ihrem Protest war auch rückwärtsgewandt. Viele Bauernhaufen zelebrierten damals das Männerbündische, und es gab in ihren Reihen auch antiklerikalen und antisemitischen Hass. Auch in der Frage, ob Gewalt angewendet werden sollte, gab es keine ganz einheitliche Meinung. Sie organisierten und bewaffneten sich – durchaus nicht nur mit Sensen und Dreschflegeln –, zogen trommelnd und pfeifend übers Land, bauten Drohkulissen auf. Sie belagerten, stürmten und plünderten Klöster, gelegentlich auch Adelssitze. Und sie nötigten und zwangen manchen, sich ihnen anzuschließen. Aber die meisten Bauernhaufen waren für Verhandlungen mit den Obrigkeiten und zeigten sich zur Verständigung, zu Kompromissen bereit – auch dafür stehen die Zwölf Artikel und die Memminger Bundesordnung. Die Gegner der Bauern reagierten trotzdem unerbittlich. Die Zwölf Artikel lösten ein donnerndes publizistisches Echo aus, gerade auch von protestantischen Gelehrten, die ihr Projekt der Reformation gefährdet sahen. Luther, der in seiner „Ermahnung zum Frieden“ Ende April 1525 noch Verständnis für die Forderungen der Bauern erkennen ließ, forderte wenig später in seiner Schrift „Wider die mörderischen und räuberischen Rotten“ die Niederschlagung der Aufstände – und prägte für lange Zeit das öffentliche Bild von den gewalttätigen Bauern. Dabei war es der Schwäbische Bund, der die militärische Austragung des Konflikts forcierte. Bei Leipheim richtete das Fürstenheer das erste schreckliche Blutbad an, dem viele weitere folgen sollten: Die Bauern und ihre Verbündeten wurden gnadenlos niedergemetzelt, öffentlich enthauptet, an Bäumen aufgeknüpft. Man brannte ihre Dörfer nieder, tötete auch Frauen und Kinder. Bis zu 100.000 Menschen bezahlten damals ihr Streben nach Freiheit mit dem Leben – eine ungeheuerliche Zahl. 500 Jahre danach ist es höchste Zeit, Sebastian Lotzer, Christoph Schappeler und die Bauern, die hier in Memmingen Freiheitsgeschichte schrieben, auf die Landkarte unserer nationalen Erinnerung zu setzen. 500 Jahre danach ist es höchste Zeit, all jene ins Licht zu rücken, die damals für Freiheit und Gerechtigkeit kämpften! Sie bereiteten den Boden, sie legten die ersten Körner jener Saat, aus der viel später unsere freiheitliche Demokratie wachsen konnte. Wir schulden ihnen Anerkennung und Respekt! Und wir haben noch so viel mehr zu entdecken und wiederzuentdecken! Hier in Memmingen haben Sie gerade eine Flugschrift aus dem Jahr 1525 erstanden, in der ein unbekannter Stadtbürger in Anknüpfung an die Zwölf Artikel seine Vorstellungen von einer Republik formulierte. Und auch in späteren Jahrhunderten entstand vieles, was wir heute zu Unrecht aus dem Blick verloren haben: die frühen demokratische Manifeste, die deutsche Jakobiner im Zuge der Französischen Revolution entwickelten; die liberalen Verfassungsentwürfe aus der Zeit des Vormärz; nicht zuletzt die Forderungen, die vor und während der Revolution von 1848 kursierten. Ich finde, der Freiheitsbrunnen, den Sie hier in Memmingen auf dem Weinmarkt errichtet haben, der gehört nicht nur in diese Stadt, sondern ich kann mir eigentlich kein stärkeres Symbol vorstellen, denn die frühen Quellen der Freiheit, sie sprudelten überall in unserem Land. Freiheitsideen flossen in vielen Rinnsalen weiter, manche versiegten, andere liefen zu großen Strömen zusammen, die schließlich in Frankfurt am Main, in Weimar, in Herrenchiemsee und Bonn mündeten – in den demokratischen Verfassungen unseres Landes. Und diese Ideen lebten in der DDR wieder auf, als sich die mutigen Frauen und Männer in Plauen, Leipzig, Ost-Berlin und vielen anderen Orten die Freiheit erkämpften – und die freiheitliche Demokratie im geeinten Deutschland möglich machten. Die Erinnerung an unsere Freiheitsgeschichte macht uns bewusst, was uns als Bürgerinnen und Bürger in diesem Land verbindet und worauf wir wirklich stolz sein können und stolz sein sollten. Auch deshalb ist es wichtig, dass wir heute die gesamtdeutsche Geschichte der Freiheit erzählen. Der Bauernkrieg mit seinen Schauplätzen in Bayern, BadenWürttemberg, Thüringen und Sachsen-Anhalt eignet sich dafür ganz besonders gut. Der Blick zurück lässt uns auch besser verstehen, was wir heute meinen, wenn wir von Freiheit und Demokratie reden. Deshalb brauchen wir historische Bildung, um denen entgegenzutreten, die sich heute zu Unrecht auf historische Freiheitsbewegungen beziehen, um gegen die Demokratie des Grundgesetzes Front zu machen! Es bleibt doch richtig: Damals riskierten und verloren mutige Menschen ihr Leben im Kampf um die Freiheit. Heute Können wir in unserer freiheitlichen Demokratie Protest äußern und friedlich um den richtigen Weg ringen. Das ist der entscheidende Unterschied! Und wer heute behauptet, Freiheit bestehe darin, dass man sich nimmt, so viel man kann, auch auf Kosten von Dritten, dem müssen wir sagen: „Ich zuerst“ ohne Rücksicht auf andere – das ist nicht die Freiheit, die unser Grundgesetz meint! In unserer Gesellschaft ist die Freiheit des Einzelnen untrennbar mit der Verantwortung für andere und für das Gemeinwesen verknüpft. Und in unserer Demokratie ist die Freiheit der Mehrheit untrennbar mit der Verantwortung verbunden, die Rechte der Minderheit zu achten und zu schützen. Die Beschäftigung mit den Zwölf Artikeln schärft unseren Blick für Fragen, auf die wir heute Antworten finden müssen. Wo endet die eigene Freiheit, wenn ihr Gebrauch zur Gefahr für andere wird? Wo endet unsere Freiheit, wenn ihr Gebrauch die natürlichen Lebensgrundlagen zerstört? Dürfen wir unsere Freiheit auf Kosten zukünftiger Generationen ausleben? Und, nicht zuletzt: Wie schützen wir uns und unsere Freiheit – vor denen, die sie , auch ohne Einsatz von Militär, von außen bedrohen, wie schützen wir sie vor den Trollen ebenso wie vor der Kommunikationsmacht der Tech-Giganten? Die Geschichte liefert uns auf diese Fragen keine fertigen Antworten. Aber sie lässt uns begreifen, dass alles, was wir hier und heute tun oder lassen, Folgen für das Leben von Menschen an anderen Orten und in der Zukunft hat. Sie macht uns bewusst: Wir alle sind aufeinander angewiesen, wir tragen Verantwortung füreinander, für die freiheitliche Demokratie und für eine lebenswerte Zukunft auf unserem Planeten! Wenn wir auf unsere Freiheitsgeschichte zurückschauen, dann stellen wir – vielleicht sogar ein bisschen erstaunt – fest, was mutige Menschen vor langer Zeit erreicht und errungen haben, allen Enttäuschungen und Rückschlägen zum Trotz. Aus der Erinnerung an ihre Kraft und ihre Entschlossenheit sollten wir heute Mut und Zuversicht schöpfen. Stellen wir uns in ihre Tradition, verteidigen wir heute das, wofür sie damals kämpfen mussten! Mein Dank gilt den vielen Menschen überall in unserem Land, die die Erinnerung lebendig halten und die vor allen Dingen immer wieder gute Ideen haben, um junge Leute für die Freiheitsgeschichte zu begeistern. Ob in Bund, Ländern oder Kommunen, in Stiftungen, Vereinen oder lokalen Initiativen: Sie alle pflegen die Wurzeln unserer Demokratie, und dafür sage ich Ihnen meinen herzlichen Dank! Ich wünsche den Landesausstellungen zum Bauernkrieg viele Besucherinnen und Besucher – hier in Memmingen ebenso wie in Bad Schussenried, in Mühlhausen und Bad Frankenhausen, in Mansfeld, in Stolberg oder in Allstedt. Im März 1525 schrieb der Verfasser der Zwölf Artikel hier in Memmingen: Aus der Heiligen Schrift ergibt sich, „dass wir frei sind und sein wollen“. Dass wir es bleiben, frei bleiben, das liegt heute in unser aller Hand! Begegnen wir den Bedrohungen von Freiheit nicht mit Gleichgültigkeit. Die Freiheitsgeschichte, die hier von Memmingen ausging, verpflichtet uns: Das Erbe der Aufständischen von 1525, das dürfen wir niemals wieder aus der Hand geben! | Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер на церемонии «500 лет Двенадцати статей» 15 марта 2025 года в Меммингене Я очень рад находиться здесь, в этом особенном месте, в этой прекрасной приходской церкви Святого Мартина. И, прежде всего, я рад быть здесь сегодня, когда мы отмечаем поистине особенную годовщину в Меммингене – годовщину, которая найдет отклик далеко за пределами вашего города, далеко за пределами региона Верхняя Швабия. Двенадцать статей, написанные здесь 500 лет назад, не были второстепенной заметкой в истории Германии, они стали толчком к движению за свободу, которое развернулось в Весной и в начале лета 1525 года эпидемия распространилась со скоростью лесного пожара по всей южной и центральной Германии, от Боденского озера до южных гор Гарц. В то время, в эпоху Реформации, Мемминген стал отправной точкой массового восстания за свободу и справедливость, подобного которому в Западной и Центральной Европе не было до Французской революции. Тот факт, что это эпохальное событие после его кровавого подавления вошло в историю как «Крестьянская война», не отражает его истинного значения. Вот почему хорошо, что в этом году во многих местах нашей страны мы вспоминаем эту раннюю главу в истории нашей свободы. Вот почему так важно, чтобы мы ясно дали понять сегодня здесь, в Меммингене: Двенадцать статей — это не только выдающееся, но и, прежде всего, непреходящее свидетельство нашей истории свободы, документ, имеющий важное значение для всей Германии, который и сегодня может многое нам сказать. Я убежден, что в эти неспокойные времена как никогда важно помнить места, деятелей, идеи и события нашей истории свободы. В настоящее время мы сталкиваемся с угрозами и нападками на либеральную демократию — как изнутри, так и извне, причем с такой силой, которую многие из нас никогда не считали возможной. И в то же время мы видим, что именно те, кто против демократического Институты спешат и хотят предоставить свободу только себе и своим коллегам. Сейчас, как никогда ранее, нам нужна исторически просвещенная память о многих мужественных женщинах и мужчинах, которые на протяжении всей насыщенной истории нашей страны неоднократно боролись против угнетения, патернализма и привилегий. Всем тем, кто ценой больших жертв отстаивал то, что стало для нас сегодня реальностью: демократическое самоопределение с равной свободой и равными правами для всех. Помня о них, мы можем яснее увидеть, что означает сегодня наша свободная демократия и какую ценность она имеет. И именно поэтому так важно, чтобы мы сегодня вместе вспомнили об увлекательном «Проекте Свобода», который начался в вашем городе 500 лет назад. Большое спасибо за приглашение! Здесь, в церкви Святого Мартина в Меммингене, 500 лет назад проповедник Кристоф Шаппелер проповедовал новое учение Реформации. Всего в нескольких улицах отсюда, в доме Крамерцунфта на Вайнмаркте, в марте 1525 года собрались представители фермеров Боденского озера, Бальтрингена и Альгоя, объединились, чтобы сформировать «Христианскую ассоциацию» и принять федеральную конституцию. В то же время скорняк, светский проповедник и писатель Себастьян Лотцер переработал требования крестьян из окрестных деревень в «Двенадцать статей», которые впоследствии стали важнейшим манифестом повстанцев и первой искрой Крестьянской войны. Говоря прямо: В начале было Слово, и Слово пришло из Меммингена. Изобретение Гутенберга позволило напечатать до 25 000 экземпляров «Двенадцати статей» весной и в начале лета сначала в Аугсбурге, а затем во многих других городах между Страсбургом и Бреслау. Анонимный памфлет распространился со скоростью ветра по обширным территориям Священной Римской империи. Его продавали на рынках, брали с собой путешественники, обсуждали в гостиницах и читали вслух на открытых площадках. Сообщения из Меммингена дошли до граждан и городских советов, подданных и властей, и повсюду, от Брайсгау до Тюрингенского леса, они вызвали протесты с требованием большей свободы. Десятки тысяч фермеров присягнули соблюдать Двенадцать статей, сделали их своей программой или адаптировали их к местным условиям. Секрет успеха, безусловно, заключался в том, что брошюра имела не только местное значение и в своем названии заявляла о том, что она говорит от имени «всех крестьян». Таким образом, Двенадцать статей создали «мы», которых на момент их написания даже не существовало. «Мы, фермеры» — это имело большую силу, возможно, как позднее «Мы, народ» в Конституции Соединенных Штатов. Еще одним взрывоопасным моментом было то, что во введении утверждалось, что выдвинутые требования оправданы Евангелием и Словом Божьим — если только фермерам не удастся доказать, используя Библию, что они ошибались в каком-то конкретном вопросе. Взрывная сила этого христианского обвинения особенно очевидна в знаменитой третьей статье: требование отмены крепостного права обосновывается там тем, что Христос искупил и выкупил людей, «пролив всю драгоценную кровь Свою, и искупил и Пастыря, и Всевышнего, никого не исключая». Поэтому из Писания следует, что мы свободны и хотим быть свободными». Уже тогда это можно было истолковать как то, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Идея неотъемлемых прав человека, которая стала реальностью лишь столетия спустя, присутствует уже на очень раннем этапе. И что еще более взрывоопасно: Двенадцать статей также поднимают фундаментальный вопрос о легитимности правления — и отвечают на него иначе, чем Мартин Лютер в своем труде «О свободе христианина». Реформатор из Виттенберга хотел, чтобы свобода понималась прежде всего как «духовная свобода», и требовал безоговорочного подчинения всем светским властям. В «Двенадцати статьях» крестьяне ясно дали понять, что они не хотят быть «совершенно свободными», то есть без власти. Однако они не считали себя обязанными подчиняться любой власти, а только тем, кто согласует свои действия со словом Божьим, например, уважая «права ближних» и «Христианское общение». Хотя Шаппелер, Лотцер и фермеры еще не сделали этого, идея современного государства или современной демократии — здесь можно распознать зачатки идеи политического порядка, в котором даже те, кто находится у власти, должны соблюдать закон, который распространяется на всех и связаны им. В монархически-феодальном обществе это была поистине революционная идея. Двенадцать статей также содержали нечто перспективное, что и сегодня трогает нас, возможно, даже формирует нас. Например, они уже содержат идею коммунального самоопределения. Они выступают против произвольных наказаний и требуют принятия писаных законов. Они борются против эксплуатации и тяжелого труда и требуют «достойной» заработной платы. И последнее, но не менее важное: они требуют справедливого распределения лесов, лугов и полей, древесины, рыбы и дичи. «Двенадцать статей» были настолько противоречивым документом, поскольку допускали самые разные толкования. Это немного похоже на головоломку, в которой многое колеблется между реформой и революцией, между возвратом к старому закону и видением нового мира, объединенного «братской любовью». Учитывая многообразие действующих лиц, противоречия в повстанческом движении не должны вызывать удивления. Восставшие — крестьяне и поденщики, ремесленники и горожане, низшее духовенство и дворяне, почти исключительно мужчины — не представляли собой полностью сплоченного движения. Большинство из них оставались приверженцами сословной системы и не ставили под сомнение притязания дворянства на власть. Часть их протеста также была обращена в прошлое. Многие крестьянские группы в то время прославляли мужскую связь, и в их рядах также царила антиклерикальная и антисемитская ненависть. Не было единого мнения и по вопросу о целесообразности применения насилия. Они организовались и вооружились — не только косами и цепами — прошли по стране, барабаня и свистя, и придумали устрашающие сценарии. Они осаждали, штурмовали и грабили монастыри, а иногда и дворянские резиденции. И некоторых они принуждали и заставляли присоединиться к ним. Однако большинство крестьянских групп выступали за переговоры с властями и были готовы к достижению взаимопонимания и компромисса — именно это и означают Двенадцать статей и Меммингенский федеральный устав. Тем не менее, противники фермеров отреагировали жестко. «Двенадцать статей» вызвали бурную реакцию журналистов, особенно среди протестантских ученых, которые увидели угрозу своему проекту Реформации. Лютер, который в своем «Увещевании к миру» в конце апреля 1525 года еще проявил понимание к требованиям крестьян, чуть позже в своем труде «Против убийственных и грабительских орд» призвал к подавлению восстаний — и надолго сформировал общественный образ жестоких крестьян. Именно Швабский союз поддержал военных заставили конфликт разрешиться. В Лейпхайме армия принца устроила первую страшную резню, за которой последовало множество других: крестьяне и их союзники были безжалостно вырезаны, публично обезглавлены и повешены на деревьях. Их деревни были сожжены, а женщины и дети убиты. До 100 000 человек заплатили жизнью за свое стремление к свободе — невероятное число. 500 лет спустя настало время поместить Себастьяна Лотцера, Кристофа Шаппелера и фермеров, которые писали историю свободы здесь, в Меммингене, на карту нашей национальной памяти. 500 лет спустя настало время пролить свет на всех тех, кто боролся тогда за свободу и справедливость! Они подготовили почву, они посеяли первые семена, из которых гораздо позже могла вырасти наша либеральная демократия. Мы обязаны им признанием и уважением! И нам еще столько всего предстоит открыть и переоткрыть! Здесь, в Меммингене, вы только что приобрели брошюру 1525 года, в которой неизвестный гражданин сформулировал свои идеи о республике в связи с Двенадцатью статьями. А в последующие столетия появилось много вещей, которые мы сегодня ошибочно упускаем из виду: ранние демократические манифесты, написанные немецкими якобинцами в ходе Французская революция; либералы Проекты конституций периода Формерца; не в последнюю очередь требования, которые высказывались до и во время революции 1848 года. Я думаю, что Фонтан Свободы, который вы воздвигли здесь, в Меммингене, на Вайнмаркте, не только принадлежит этому городу, но я не могу себе представить более сильного символа, потому что ранние источники свободы били ключом по всей нашей стране. Идеи свободы продолжали литься многочисленными ручейками, некоторые из них иссякали, другие сливались в огромные потоки, которые в конечном итоге вливались во Франкфурт-на-Майне, Веймар, Херренкимзее и Бонн — в демократические конституции нашей страны. И эти идеи возродились в ГДР, когда отважные женщины и мужчины в Плауэне, Лейпциге, Восточном Берлине и многих других местах боролись за свободу — и сделали возможной либеральную демократию в объединенной Германии. Вспоминая нашу историю свободы, мы осознаем, что объединяет нас как граждан этой страны и чем мы можем и должны по-настоящему гордиться. Вот почему так важно, чтобы мы сегодня рассказали общегерманскую историю свободы. Для этих целей особенно хорошо подходит «Крестьянская война», события которой разворачиваются в Баварии, Баден-Вюртемберге, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Оглядываясь назад, мы также лучше понимаем, что мы имеем в виду сегодня, когда говорим о свободе и демократии. Вот почему нам необходимо историческое образование, чтобы противостоять тем, кто сегодня ошибочно ссылается на исторические освободительные движения, чтобы противостоять демократии Основного закона! Это остается правдой: тогда храбрые люди рисковали и теряли свои жизни в борьбе за свободу. Сегодня, в нашей свободной демократии, мы можем протестовать и мирно бороться за правильный путь. Вот в чем принципиальное отличие! И тем, кто сегодня утверждает, что свобода заключается в том, чтобы брать столько, сколько можешь, даже за счет других, мы должны сказать: «Сначала я», не считаясь с другими — это не та свобода, которую подразумевает наш Основной закон! В нашем обществе свобода личности неотделима от ответственности за других и за сообщество. И в нашей демократии свобода Большинство неразрывно связано с ответственностью уважать и защищать права меньшинства. Изучение Двенадцати статей обостряет наше понимание вопросов, на которые нам необходимо ответить сегодня. Где заканчивается свобода человека, когда ее использование становится опасным для других? Где заканчивается наша свобода, когда ее использование разрушает естественные основы жизни? Имеем ли мы право реализовывать свою свободу за счет будущих поколений? И последнее, но не менее важное: как нам защитить себя и свою свободу — от тех, кто угрожает ей извне, даже без применения военной силы, как нам защитить ее от троллей, а также от коммуникационной мощи технологических гигантов? История не дает нам готовых ответов на эти вопросы. Но это заставляет нас понять, что все, что мы делаем или не делаем здесь и сейчас, имеет последствия для жизни людей в других местах и в будущем. Это заставляет нас осознать: мы все зависим друг от друга, мы несем ответственность друг за друга, за свободную демократию и за будущее, достойное жизни на нашей планете! Когда мы оглядываемся на нашу историю свободы, мы понимаем – возможно, даже с некоторым удивлением – чего достигли и чего победили отважные люди много лет назад, несмотря на все разочарования и неудачи. Сегодня мы должны черпать мужество и уверенность в памяти об их силе и решимости. Давайте же сохраним их традиции и защитим сегодня то, за что им пришлось бороться тогда! Я выражаю благодарность многим людям по всей нашей стране, которые хранят память и, прежде всего, у которых всегда есть хорошие идеи, чтобы вдохновить молодежь на историю свободы. Будь то на федеральном, государственном или местном уровнях, в фондах, ассоциациях или местных инициативах: вы все питаете корни нашей демократии, и за это я искренне благодарю вас! Я надеюсь, что государственные выставки, посвященные Крестьянской войне, привлекут много посетителей — как здесь, в Меммингене, так и в Бад-Шуссенриде, Мюльхаузене и Бад-Франкенхаузене, в Мансфельде, в Штольберге и в Альштедте. В марте 1525 года автор Двенадцати статей писал здесь, в Меммингене: Из Священного Писания следует, «что мы свободны и хотим быть свободными». То, что мы останемся такими, что мы останемся свободными, сегодня в наших руках! Давайте не будем реагировать на угрозы свободе равнодушно. История свободы, которая началась здесь, в Меммингене, обязывает нас: наследие повстанцев 1525 года, Мы никогда больше не должны забывать их! |
| | |












